„Vergaberecht neu denken“ ist unser Versprechen. Unser innovativer Zugang und die jahrzehntelange Erfahrung bilden das Fundament für unsere Kanzlei, unseren Ansatz und unsere Arbeit.
Aktuelles

News
Künstliche Intelligenz auf Stimmenfang

News
Auch Algorithmen brauchen Ethik

News
Gefälschte Daten verschmutzen die Demokratie

News
Die Grenzen des Machbaren definieren
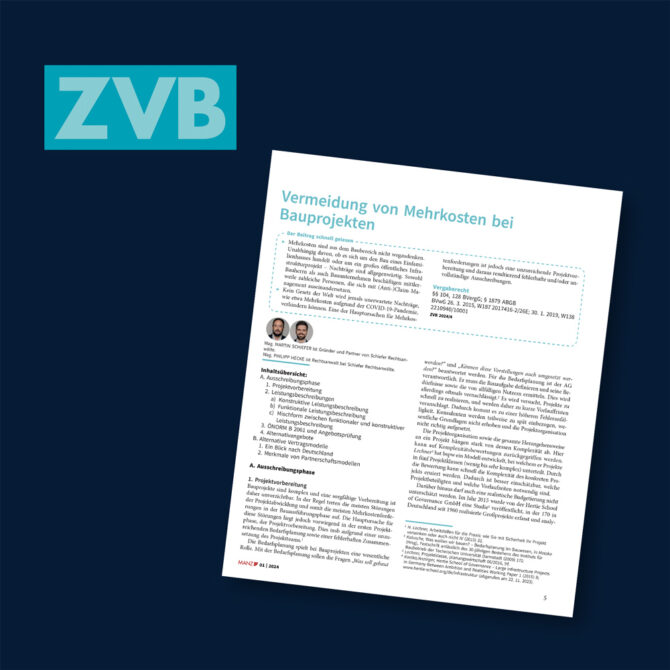
News
Vermeidung von Mehrkosten bei Bauprojekten

News
Leistbar ist gut, lebbar ist besser

News
Vergaberecht ist ein Belohnungs-Tool

News
Gin und weg!

News
Sind Sie Possibilist:in?

News
Der Preis ist heiß
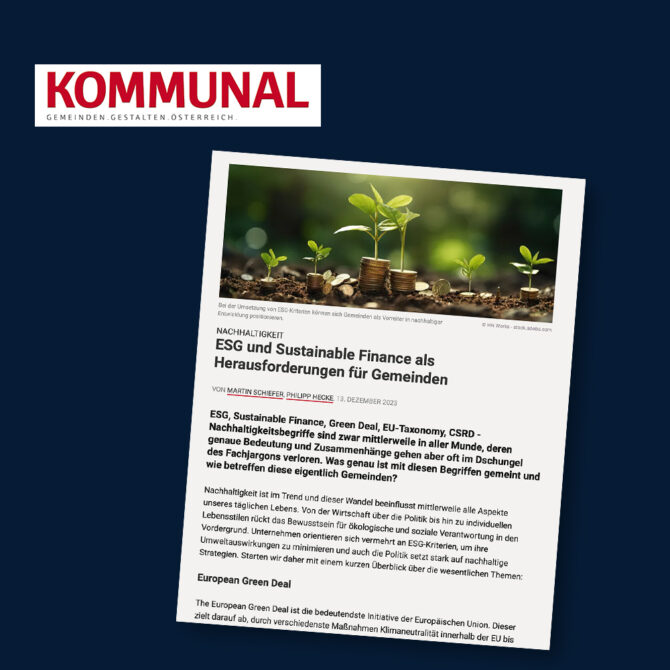
News
ESG und Sustainable Finance als Herausforderungen für Gemeinden

News
Große Mehrheit der Gemeinden mit Beschaffungswesen zufrieden

News
Was möglich ist, entscheiden wir.

Martin Schiefer, Partner Schiefer Rechtsanwälte, lädt in die spannende Welt des Vergaberechts ein! Gemeinsam mit Christian Baier teilt er im monatlichen Podcast kompakte Einblicke und praktische Tipps zu den rechtlichen Themen aus seinem Alltag. Denn Vergaberecht ist überall – branchenunabhängig und zukunftsweisend.
Wir wünschen viel Freude beim Zuhören!






